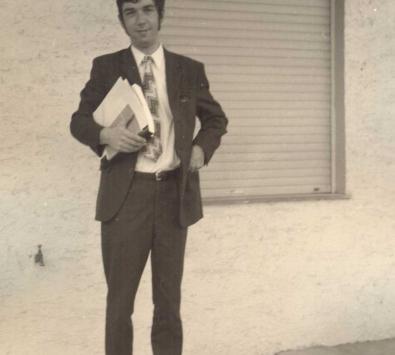Der Forschungsverbund Universitätsgeschichte betrachtet es als eine seiner Aufgaben, das vorhandene Wissen ehemaliger Angehöriger der Universität zu dokumentieren.
Es wurden in verschiedenen Projekten, beginnend mit der Projektgruppe Friedrich Moll / Marcus Giebeler, Erinnerungen von Zeitzeug:innen gesammelt, die wir im Folgenden vorstellen möchten:
Schriftliche Erinnerungen von Zeitzeug:innen an die Frühzeit der Universität
Anfang November 1948 kam ich als frischgebackener Abiturient aus Bernkastel-Kues in das stark zerstörte Mainz und betrat die Johannes Gutenberg-Universität, um Mathematik, Physik und Chemie zu studieren. Ich hatte großes Glück, denn durch einen Bekannten erhielt ich bald einen Platz in einem Drei-Bett-Zimmer im Dachgeschoß der ehemaligen Flak-Kaserne. Hier konnte man günstig wohnen, musste aber für Essen und die täglichen Dinge des Lebens selbst sorgen. In der Mensa wurde natürlich auch Essen angeboten, aber soviel Geld hatten wir ein halbes Jahr nach der Währungsreform (40 Deutsche Mark als „Kopfgeld“) nicht. Viele Studenten gingen deshalb zu einer bestimmten Baracke auf dem Universitätsgelände „hoovern“. Dort gab es für sehr wenig Geld ein Eintopf-Mittagessen der „Hoover-Speisung“, eine von den Amerikanern eingerichtete Hilfsmaßnahme für deutsche Studenten (benannt nach dem damaligen US-Präsidenten Herbert Hoover). Abends aß man Brote oder versorgte sich „warm“ in der Teeküche des Studentenheims (meistens mit Nudeln oder Reis).
Die Vorlesungen begannen. Jeder Student musste im 1. Semester auf dem Universitäts-Freigelände Aufräumungsarbeiten leisten, weil die vorher dort stationierten französischen Besatzungstruppen dieses ziemlich verwahrlost zurückgelassen hatten. Für die Physikstudenten war es Pflicht, ein handwerklich-technologisches Praktikum in Metallbearbeitung (Feilen, Schweißen, Drehen) zu absolvieren. Aus „Trümmermetall“ wurden dann für die Praktika einfache physikalische und chemische Gräte hergestellt.
Für uns Neulinge war das Studium Generale besonders interessant. Zusätzlich zum Hauptstudium wurden kostenlos Vorlesungen aus verschiedenen Disziplinen wie Philosophie, Kunstgeschichte, Naturwissenschaften (z. B. bei dem bekannten Atomwissenschaftler Prof. Dr. Strassmann) angeboten.
Ende eines jeden Semesters war es möglich, Fleißprüfungen in einem der Pflichtfächer zu machen. Bei positivem Ergebnis erhielt man dann Gebührenerlaß oder eine Barbeihilfe.
Auf dem Universitätsgelände gründeten die beiden christlichen Kirchen Studentengemeinden. Die katholische Studentengemeinde feierte den Gottesdienst in einem als Kapelle umgestalteten Kellerraum im Hauptgebäude der ehemaligen Kaserne. Dort probte auch eine Choralschola und ein Singkreis. Der katholische Studentenpfarrer Dr. Strasser besprach regelmäßig neu erschienene religiöse und profane Literatur des In- und Auslands, vor allem solche, die im Dritten Reich in Deutschland verboten war. Viele Studenten besuchten diese Vorträge mit großem Interesse, ebenso die Konzerte des Collegium Musicum mit seinem Dirigenten Prof. Dr. Ernst Laaf.
Inzwischen hatten sich an der Universität auch politische Gruppierungen gebildet. Zum Aufbau einer studentischen Mitverwaltung wurden die Studenten zu Wahlen von Fakultätsräten und zur Wahl eines Studentenparlaments aufgerufen. Im Wintersemester 1952/53 und im Sommersemester 1953 war ich Sprecher der Naturwissenschaftlichen Fakultät und Vizepräsident des Studentenparlamentes. Dadurch bekam ich Einblick in die Arbeit der studentischen Mitverwaltung.
Bei all den oft großen Schwierigkeiten, die bei der Wiedereröffnung der Universität Mainz auftraten, darf man die erfreulichen und schönen Dinge nicht unerwähnt lassen. Beispielsweise wurde auf dem Universitätsgelände, wie in Mainz üblich, unbeschwert Fasnacht gefeiert. Auch das von Studenten gegründete Kabarett mit Hans Dieter Hüsch war allseits beliebt.
Ein Höhepunkt in der Entwicklung der wiedereröffneten Universität war der Besuch des Bundespräsidenten Theodor Heuss in Mainz (17. Januar 1953). Dort nahm er an der Einweihung des „Domus Universitatis“ teil und besuchte auch die Universität.
Wenn ich über meine Studentenzeit in Mainz (1948 – 1954) berichte, so will ich den Einfluß Frankreichs auf die Wiedereröffnung der Universität Mainz nicht unerwähnt lassen.
Der damalige Prorektor Adalbert Erler hat im Wintersemester 1946/47 mit Recht betont, es stehe einmalig in der Geschichte da, „dass eine siegreiche Nation schon wenige Monate nach Kriegsende im besetzten Land die Errichtung einer neuen Hochschule nicht nur genehmigt, sondern sogar hilfreiche Hand für ihren Aufbau“ (1) geleistet habe.
In diesem Zusammenhang möchte ich über einen Ferienkurs berichten, zu dem Anfang 1950 das „Hochkommissariat für kulturelle Belange der Generaldirektion der Republik Frankreich in Deutschland“ einlud. So konnte ich an einem internationalen Studententreffen Mainz-Aix-en-Provence teilnehmen und wurde stolzer Besitzer einer Teilnahme-Urkunde „Rencontre internationale d´ètudiants Mayence-Aix-En-Provence 15 Aoút – 15 Septembre 1950“. Dieser Ferienkurs war meines Wissens das erste rheinland-pfälzische Studententreffen nach dem Krieg.
Am 15. August 1950 fanden sich auf dem Campus der Universität Mainz etwa 35 Studentinnen und Studenten aus Frankreich, Deutschland, Schweden, Belgien und einem Studenten aus Tunesien ein, um am nächsten Morgen zu einem zweiwöchigen Aufenthalt in Bacharach/Rhein aufzubrechen. Von dort aus machten wir nicht nur Exkursionen in die nähere und weitere Umgebung an Rhein und Mosel, sondern wir wanderten, diskutierten über „Gott und die Welt“, sangen internationale Lieder und machten die ausländischen Teilnehmer mit den Weinen der Region bekannt. Nach den zwei Wochen ging es über Mainz mit der Bahn nach Aix-en-Provence, wo wir in der Cité Université wohnten. Eine wunderschöne Zeit, insbesondere für die nichtfranzösischen Studenten, begann. Bei Exkursionen in die Umgebung von Aix-en-Provence lernten wir die schöne Landschaft von Südfrankreich kennen. An einem Abend fand ein offizieller Empfang im Office du Tourisme statt. Für uns Deutsche war es besonders eindrucksvoll, so kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs in Frankreich mit ausländischen Studenten zusammen zu sein.
Ein anderes positives Ereignis in der schwierigen Anfangszeit der Universität war für mich die Begegnung mit Prof. Dr. Hans Rohrbach, Professor für Mathematik. Er gehörte zu denjenigen Professoren, die am Ende des Krieges von der deutschen Karls-Universität Prag vertrieben wurden und in Mainz Aufnahme fanden. Er machte uns im letzten mathematischen Oberseminar den Vorschlag, auf freiwilliger Basis sich mit dem deutschen Theologen und Universalgelehrten Nikolaus Cusanus (1401 – 1464) zu befassen, was wir auch taten. Es waren für uns Teilnehmer interessante und lehrreiche Stunden, seine mathematischen Gedankengänge kennen zu lernen. Besonders erfreulich war, in dieser kleinen Runde persönlichen Kontakt mit Prof. Rohrbach zu bekommen.
Es ließe sich noch manches herausragende Ereignis dieser Zeit berichten, aber ich möchte damit meinen Bericht abschließen.
(1) Helmut Mathy: Die Universität Mainz 1477 –1977. Mainz, 1977, S. 291.
Das Studium in Mainz im Jahr 1946 und auch noch einige Jahre danach hatte Besonderheiten, die man heute, so glaube ich, nur richtig verstehen kann, wenn man etwas von der Vorgeschichte damaliger Studenten, also auch von meiner, weiß.
1927 wurde ich in Breslau als Tochter eines Ingenieurs geboren. Nach je vierjährigem Besuch der Volksschule und der Mittelschule des Ursulinenklosters in Breslau trat ich, nach Schließung aller konfessionellen Schulen durch die Nazis, in die Obertertia der König-Wilhelm-Schule in Breslau ein. Ich verlebte eine sehr glückliche Kindheit, in der ich wirklich alles hatte, was ich brauchte oder mir wünschte. Auf unserem Motorboot verbrachten wir fast jedes Wochenende und auch ganze Ferien auf der Oder. Ich war eine große Schwimmerin und bin bei vielen Wettkämpfen, auch Deutschen Meisterschaften, mitgeschwommen.
1944 aber wurden alle Schulen geschlossen. Ich kam Anfang November, nach Einsatz in einem Rüstungsbetrieb, zum Reichsarbeitsdienst und wurde auf einem Bauernhof in Oberschlesien eingesetzt. Bei dieser, wie auch bei einzelnen nachfolgend beschriebenen Erinnerungen greife ich nicht nur auf meine Aufzeichnungen und meinen Lebenslauf zurück, sondern auch auf ein nicht publiziertes Interview, das 1998 Sabine Klapp, die mit Dozentin Dr. Hedwig Brüchert zusammenarbeitete, mit mir führte.
Im Januar 1945 bin ich aus dem Arbeitsdienst vor den Russen geflohen, hinein in einen Zug voller Verwundeter. Mit Rucksäcken, die wir uns im Arbeitsdienst aus unseren Kopfkissen genäht hatten, drängten wir uns in die Viehwaggons des Zuges. Als der Zug plötzlich in Breslau anhielt, floh ich weiter zu unserer Wohnung, die voller für mich fremder Menschen war, die auf irgendeine Fahrmöglichkeit warteten, um noch aus Breslau herauszukommen. Meine Familie hatte die Wohnung schon verlassen. Mit einer alten Zinkbadewanne voller Einmachgläser und Kartoffeln gelang mir bei eisiger Kälte die weitere Flucht nach Liegnitz. Mein Vater hatte einen Lastwagen vermitteln können, mit dem wir die tiefwinterlichen Straßen befuhren, auf denen sich zu Fuß flüchtende Menschen drängten. Dort traf ich endlich meine Mutter und meine beiden Schwestern. Mit diesen bin ich dann von Liegnitz nach Görlitz bis ins Erzgebirge nach Marienberg weitergeflohen. Wir schliefen dort zusammen mit einem Hund in einem kleinen schmalen Zimmer. Wir erlebten die Russen erstmalig am Tag der Kapitulation. Von da an hielten wir Frauen uns versteckt und waren in ständiger Angst, von den Russen entdeckt zu werden. Mein Vater war zuletzt an der Ostfront eingesetzt gewesen und kam nach der Kapitulation, um viele Jahre gealtert, über die Tschechei zu uns. Aus der russischen Zone sind wir dann, mit zwei selbstgebauten Leiterwagen mühsam und oft in Lebensgefahr über die „Grüne Grenze“ bei Hof zu den Amerikanern gestoßen. Main Vater hatte keine Kräfte mehr und musste von uns, auf dem Leiterwagen liegend, transportiert werden.
In Bayern recht unfreundlich aufgenommen, zogen wir mit unseren Leiterwagen weiter nach Westen, über Koblenz nach Mayen in der Eifel, dem Geburtsort meiner Mutter. Von der Schwägerin meiner Mutter aufgenommen, lebten wir dann mit bis zu 18 Personen in dem stark zerstörten Haus der Großeltern ohne Strom und ohne Wasser. Wir mussten das Wasser weit weg holen, wir hatten aber Kartoffeln und Öl und dadurch haben wir nicht soviel Hunger gelitten. Es ging uns , für die damaligen Verhältnisse, sehr gut und dadurch, dass unter uns alles geteilt wurde, ergab sich, darüber hinaus, ein wunderbares Gefühl des Aufgehobenseins.
Noch im Jahr 1945 wurden wir alle sehr krank, aber auch durch tatkräftige Hilfe anderer ist alles gut über die Bühne gegangen: Meine Großmutter, der Bürgermeister und der Pfarrer halfen. Mein Vater hatte immer noch keine Existenz und wir waren drei Kinder ohne Ausbildung. Mein Bruder kam später, nach 3-jähriger französischer Kriegsgefangenschaft, noch dazu. Ich hatte von Breslau her nur meine Versetzung in die Oberprima, konnte dann aber, zusammen mit vielen heimgekehrten Kriegsteilnehmern, mein Abitur in Mayen machen.
Irgendwann, Anfang 1946, ist meine Mutter nach Mainz gefahren, da dort eine Universität eröffnet wurde. Sie hat dann ein Gespräch mit Rektor Josef Schmid gehabt und sie, ich weiß nicht wie es ihr gelungen ist und ob eine Ersatzwährung im Spiel war, kam nach Mayen zurück und hatte für mich einen Studienplatz in der Tasche. Meine Mutter hat mich also in Mainz immatrikuliert. Sie hat damals auch in der Stadt irgendwelche Leute angesprochen, ob sie nicht ein Bett für mich hätten. Sie kam dann also zurück und hatte auch eine Unterkunft für mich und die war in Gonsenheim.
Nach dem ersten Semester habe ich mich von der naturwissenschaftlichen Fakultät zu der Medizinischen Fakultät umgemeldet. Da alle Medizinstudenten zunächst auch Naturwissenschaften, also Physik, Chemie, Biologie, studieren müssen, konnte ich ohne Verlust von den Naturwissenschaften zur Medizin überwechseln.
Mit Papier und Büchern war es damals sehr schlecht bestellt. Ich schrieb die Vorlesungen nach auf alten Kontobüchern meiner Großeltern. Dieses gelbe Papier habe ich geschnitten und zusammengebunden. Bücher hatten wir überhaupt keine.
Wir hatten einen ganz phantastischen Professor für Anatomie, Professor Dabelow, der ein ausgezeichneter und begeisterter Zeichner war. Er stand jeden Tag an der Tafel. Er hatte die Fähigkeit, zweihändig zu malen. Wenn er dann beispielsweise das Gehirn an die Tafel malte, dann tat er es mit zwei Händen. Es ging sehr symmetrisch zu. Wir haben alles mitgemalt und mitgeschrieben. Die ungeheizten Hörsäle waren sehr voll und wir saßen auf den Stufen. Hinsichtlich der Kleidung war es angenehm, dass nicht nur wir selbst keinen Reichtum hatten sondern alle, die mitstudierten, auch nichts. Keiner brauchte und konnte dem anderen etwas vormachen, wir waren alle sehr zufrieden.
Aus den Briefen, die ich damals an meine Eltern geschrieben habe, wird mir im nach hinein wieder bewußt, wie viel Hunger wir hatten. Alle Briefe drehen sich darum, wo kriegen wir was zu essen her? Wir haben damals schon ziemlich Hunger gelitten.
In der Anfangszeit habe ich bei der Familie gewohnt, die meine Mutter angesprochen hatte. Die Miete kostete damals 25 Reichsmark. Es war sehr kalt in dem Zimmer. Ich habe mich angezogen ins Bett gelegt, mich dick zugedeckt und trotzdem noch sehr gefroren. Bald hatte ich die Möglichkeit , in die Universität zu ziehen und zwar in diese Dachkammern. Wir wohnten, sage und schreibe, mit vier Mädchen in einem kleinen Zimmerchen. Es gab immer ein Bett und einen Sekretär und wieder ein Bett und einen Sekretär und einen kleinen Tisch in der Mitte. Daneben gab es eine kleine Kochküche. Dort kochten wir dann immer unser Süppchen. Wenn wir sehr gefroren haben, stellten wir einen Kocher unter den kleinen Tisch und unsere Füße drunter. Eine ältere Dame, die uns bewachte, durfte nicht entdecken, dass wir da etwas Heißes unter dem Tisch hatten.
Während die Männer bei der Trümmerbeseitigung helfen mussten, mussten wir Mädchen soundsoviele Arbeitsstunden in der Küche ableisten. Dazu gehörte unter anderem auch Kirschenernten und zu zwanzig in der Küche entkernen.
Es gab damals schon eine Mensa, aber man konnte wenig darin kaufen, beispielsweise Brötchen auf Brotmarken. Eine Zeitlang gab es auch regelmäßig Spinat und ich konnte ihn schließlich nicht mehr sehen. Aber wir sind relativ häufig nach Hause gefahren, weil wir auf dem Rückweg immer Lebensmittel mitgenommen haben. Dazu gehörten auch irgendwelche Suppen, die meine Mutter gekocht hatte oder Brotaufstrich, z. B. Leberwurstaufstrich aus Maggi und Haferschleim, den sie fabriziert hatte.
Mittags traf ich mich regelmäßig mit anderen Studenten, meist aus Mayen, in der Mensa und wir haben uns dort aufgewärmt. Da ich so ziemlich die einzige Studentin aus Mayen war, brachten sie mir immer ihre kaputten Strümpfe mit, die ich dann gestopft habe. Es war immer sehr fröhlich und wir waren alle zufrieden.
Die finanzielle Situation war nicht einfach. Mein Vater hatte noch längere Zeit keinen Verdienst. Erst als aus Breslau alte Monteure zu ihm kamen, hat er wieder angefangen, als Heizungs-Ingenieur Aufträge anzunehmen. Ich musste ja Studiengebühren bezahlen und das war relativ viel. Von den Eltern bekam ich Beträge so um 30 Mark. Die Miete kostete 25 Mark, ein Brötchen kostete 3 Pfennig. In einem Ausgabenbuch habe ich alle Sachen mühsam aufgeführt.
Lehrbücher, in denen der Vorlesungsstoff nachgelesen werden konnte, gab es in dieser Anfangszeit der Universität nicht. Es gab auch noch keine Universitätsbibliothek. So hat man praktisch alles Wesentliche über die Vorlesungen der Professoren erfahren. Abgesehen von kleinen Abschriften hat man mitgeschrieben, mitgemalt. Zu Hause haben wir es dann in Hefte übertragen. Ich habe wunderschöne Gemälde von allen Organen gemalt und dadurch habe ich es mir auch sehr gut einprägen können.
Wir haben hervorragende Professoren gehabt. Zum Beispiel Professor Watzka, der kam von Prag her, eine Seele von Mensch. Die Professoren waren uns alle sehr zugetan.
Es gab dann auch die ersten Stipendien. Man musste dazu eine Fleißprüfung machen. Wir haben eigentlich keine Vorlesung versäumt, weil wir uns auch prüfen lassen mußten. Wir fingen morgens um acht Uhr an und haben dann bis mittags durchgearbeitet.
Ich hatte Bekannte drüben in Schierstein und habe versucht, oft in diese Familie mit 5 Kindern zu kommen. Der Familienvater war Doktor Mainka, der schon in Schlesien ein sehr gastfreundliches Haus gehabt hatte. Zu seinen vielen Kindern kamen immer Kinder von außerhalb dazu; alles was sie hatten, haben sie mit uns geteilt.
Als Räume für unsere Vorlesungen hatten wir unter anderem die Aula und das Auditorium maximum. In unserem Freundeskreis waren Frauen und Männer. Wir waren eine ganz große Clique und mussten morgens immer sehen, dass wir im Hörsaal Platz bekamen. Es waren immer zwei, die für den ganzen Freundeskreis freigehalten haben. Meist saßen wir auf den Stufen.
Mit unserem Freundeskreis haben wir viele Fahrradtouren gemacht, so in die Eifel, an den Bodensee. Im Rahmen eines Austausches mit französischen Studenten waren wir auch in Frankreich und kamen auf unseren alten Rädern in einer wunderschönen Reise nach Paris, Bordeaux und bis an die Biscaya,
Wir haben damals schon sehr viele allgemeine Vorträge gehört, Vorläufer der Vorlesungen des Studium Generale. Regelmäßig hörten wir Professor Holzamer, Philosophie, es gab wunderbare Musikstunden und es gab Professor Gerke, der Kunstgeschichte vortrug. Diese Vorlesungen waren überlaufen. So war es nicht nur die Medizin, die uns glücklich machte. Wenn an der Universität Konzerte stattfanden, die ersten Konzerte in Mainz, dann saßen wir draußen auf dem Mäuerchen und haben alles mitgehört. Wir waren so hungrig auf Bildung, dass wir alles mitgenommen haben.
Mein Mann hat mitstudiert vom ersten Semester an. Er kam immer angefahren von Hattersheim. Seine Eltern stammten aus Mainz und waren ausgebombt, sie hatten keine Wohnung mehr in Mainz gefunden und wohnten so in Hattersheim. Er kam jeden Morgen von dort angefahren und lief von Kastel bis zur Universität hoch und am Abend wieder zurück nach Kastel. Damals waren das keine Entfernungen, das war selbstverständlich.
Vom Leben in der Stadt haben wir nicht viel mitbekommen. Mainz war eine ganz arme Stadt, eine selten arme Stadt. Wir liefen sehr ärmlich herum. Die Männer hatten noch ihre alte Soldatenkluft. Es gab rotkarierte Bettwäsche und daraus habe ich mir ein fesches Dirndl genäht. Die Schürze war aus einer alten roten Hakenkreuzfahne geschnitten. Wenn wir mal elegante Leute sehen wollten sind wir nach Wiesbaden auf die Wilhelmstraße gefahren. Dort gab es schöne Schaufenster und, im Gegensatz zu Mainz, gut gekleidete Menschen.
Wir haben unser Studium selbst finanzieren müssen. Es gab stellenweise Stipendien, aber das Leben kostete ja auch etwas. Wir haben also nebenbei gearbeitet. In Mainz gab es von Anfang an die Fasnachtsbälle und wir versuchten, uns dort irgendwie zu betätigen. Ich habe mich für die Fasnachtssitzungen im Schloß gemeldet und alle Präsidenten dort miterlebt. Man hat mir angetragen, Zigaretten zu verkaufen und ich fand überhaupt nichts dabei. Ich lief also mit einem Bauchladen herum, in dem alle Zigarettensorten drin waren. Die haben wir dann während der Sitzungen verkauft und es kam immer ein bisschen was zusammen. Wir haben dann auch Zigarettenmarken bekommen. Zigarettenmarken waren auf dem Schwarzmarkt sehr teuer. Ich habe zwar auch geraucht, aber zum Teil meine Zigaretten verkauft, es waren immer so kleine Beträge, die es dafür gab.
Als ich dann schon eingeweiht war im Schloß, kam ich zu höheren Diensten. Ich habe dann hinter der Sektbar gestanden und Sekt ausgeschenkt. So hat sich die Nacht, je nachdem wie man ausgegossen hat, schon mehr gelohnt. Das waren dann auch wieder nette Erinnerungen. Die Leute kannten einen schon alle. Wir haben auch gearbeitet, wenn irgendwelche Ausstellungen waren oder haben Luftballons verkauft. Oder wir haben in der Sparkasse gearbeitet und zwar in den Nächten, wenn das Jahr zu Ende ging und die Bilanzen gemacht werden mussten. Wir mussten ja Studiengebühren zahlen und wollten nichts verpassen.
Zum Abschluß der vorklinischen Semester mussten wir dann das Physikum machen. Mit dem Abschluß der Klinischen Semester hatte ich dann, trotz allem, das Studium sehr schnell durchgezogen. Ich machte 1951 mein medizinisches Staatsexamen. Obwohl ich durch die Flucht Zeit verloren hatte, war ich also mit 24 Jahren fertig. Ich habe dann sofort mit meiner Ausbildung angefangen und zwar in der Kinderklinik. Zunächst war ich in der Mainzer Kinderklinik bei Professor Köttgen tätig. Dann war ich in Wuppertal, das damals die modernste Kinderklinik in Deutschland hatte.
1955 habe ich geheiratet. 14 Monate nach der Geburt unseres Sohnes kam die Tochter auf die Welt. Danach habe ich die Facharztausbildung - es fehlten mir noch 3 Monate - abgeschlossen und, nach einer kurzen Pause, als Kinderärztin für das Gesundheitsamt gearbeitet. Ich organisierte erstmals in Mainz Reihenuntersuchungen bei den vierjährigen Kindern aller Kindergärten des gesamten Stadtgebietes. Ich prüfte die Sprache der Kinder und führte mit entsprechenden Testgeräten Seh- und Hörprüfungen durch. Da es damals noch keine vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen bei Kindern gab und auch meine Testgeräte noch wenig im Einsatz waren, konnte ich viele Kinder noch vor der Einschulung zu einer fachärztlichen Behandlung weiterleiten. Mit 62 Jahren ging ich in den Ruhestand, um jüngeren Kollegen Platz zu machen.
Meine erste Bekanntschaft mit dem Campus der Universität habe ich bereits vor 1945, also vor der Universitäts-Wiedergründung, gemacht. In der Endphase des zweiten Weltkriegs hatten wir in einer der damaligen, staatlich organisierten Jugendgruppen, so jung wir mit unseren 12 Jahren waren, für den Nachschub auf dem Flak-Turm des Luftwaffenstützpunktes, einem späteren Wahrzeichen der Johannes Gutenberg-Universität, zu sorgen.
Davor lag das Einzelschicksal einer in Vorkriegs- und Kriegszeit heranwachsenden Generation: 1933 in Bad Homburg geboren, besuchte ich dort 1939 – 1944 Volks- und Oberschulen und legte dann 1953 das Abitur am Mainzer Schloß-Gymnasium ab. Ein prägendes Erlebnis der Kriegszeit war für mich, dass ich, als Mainz nach dem schweren Luftangriff 1944 brannte, allein mit einer zwölfköpfigen Jugendgruppe unser brennendes Apothekenhaus am Gautor zu räumen hatte. Dieses Haus stammte noch aus dem Jahr 1375, seine berühmte Haus-Madonna war nach Darmstadt gegeben worden, wo sie allerdings dann durch eine Phosphor-Brandbombe angesengt wurde. Am gleichen Tag brannte auch die eng benachbarte Barockkirche St. Stephan aus. Anderthalb Jahre später, im Februar 1945, wurde der fertig gestellte Notbau des Apothekenhauses erneut, diesmal von 3 Sprengbomben, getroffen. Nach Notunterbringungen drei Häuser weiter und der Einrichtung eines Arzneimittellagers in der Stephanskirche hat mein Vater dann 1951 das Apothekenhaus wieder aufgebaut. Die damals noch vorgeschriebene zweijährige praktische Zeit habe ich, ebenso wie später das Approbationsjahr in der elterlichen Gautorapotheke abgeleistet. Während der Pharmaziepraktikantenzeit begann ich schon mit der Anlage meines zunächst 300 Heilpflanzen umfassenden Herbariums; heute, nach weiten Reisen in beinahe alle Teile der Welt, erstreckt es sich auf sechzehn Leitz-Ordner.
Mein Start 1955 als Student an der wiederbegründeten Mainzer Universität war von dem Ratschlag meines Vaters beeinflusst, im ersten Semester, so wie er selbst es einstens in Straßburg getan hatte, auf jeden Fall an der Universität breite Umschau zu halten, und, vor allem, Vorlesungen außerhalb des eigentlichen Studienfachs zu hören. So habe ich bei meinem Studienbeginn 1955 insbesondere Vorlesungen in evangelischer und katholischer Theologie und innerhalb dieser Fächer über den Islam gehört. In meinem eigentlichen Studienfach, Pharmazie, hatte ich zwar einen Laborplatz belegt, wurde aber, zumindest im ersten Semester, vor Ort, nur am ersten und letzten Semestertag gesehen. Zu meinen Semesterkollegen gehörten damals noch einzelne Kriegsteilnehmer, ein ganzer Teil der Semesterkollegen war bereits verheiratet.
Ab dem zweiten Semester habe ich dann ganz regulär die empfohlenen Vorlesungen und vorgeschriebenen Praktika besucht. Und ich habe, damals nicht unüblich, von morgens sehr früh bis abends spät im Labor gearbeitet und hatte schon in fünf Semestern die Praktika beendet, ohne je ein Problem mit Zwischenprüfungen zu haben. Mit dem Kustos des pharmazeutischen Instituts, Dr. Hochstätter, kam ich gut zurecht, bei Problemen war er immer ansprechbar, sehr konstruktiv und hilfsbereit. Das damalige pharmazeutische Institut in einem Altbau am Johann Joachim Becher-Weg angesiedelt, war spärlich mit Gläsern und Laborgeräten ausgestattet. Ich habe deshalb in der Apotheke vorhandene Geräte ins Labor gebracht, wo sie natürlich auch, glücklicherweise nur vorübergehend, andere Liebhaber fanden.
Der Institutschef, Prof. Hans Rochelmeyer , kam jede Woche einmal in jedes Institutslabor, hat sich die laufenden Versuche angeschaut und sich mit jedem, den er gekannt hat, unterhalten. Aber er kam auch immer wieder in unsere Apotheke und hat sich dort mit uns unterhalten. Ich konnte ihm zwanglos erzählen, was ich in Vorlesungen und Praktika nicht verstanden hatte. Wenn ich ihn bei analytischen Problemen, etwa einer unerwarteten Ausfällung, fragte: „Hab` ich das richtig gemacht?“, kam häufig, mit Autorität, die sehr bestimmte Antwort: „Nein, das muss so gemacht werden!“
Mein Vater war sehr an Botanik interessiert; nach Kriegsende war er zum Naturschutzbeauftragten der Stadt Mainz ernannt worden, das Glacialrelikt „Gonsenheimer Sand“ war sein besonderes Anliegen. Daraus ergaben sich intensive Kontakte mit den systematischen Botanikern, den Professoren Wilhelm Troll, Hans Weber und Klaus Stopp.
Der oberste Gärtner der Universität Hohmann, der insbesondere für Neuanlagen des Botanischen Gartens zuständig war, und ich selbst waren begeisterte Motorradfahrer, die auf den Strassen von ganz Rheinhessen zu Hause waren. In den Anfängen unserer 30jährigen Bekanntschaft fuhren wir häufig gemeinsam zum Gonsenheimer Sand und ich zeigte ihm dort Standorte der gesuchten Glacialrelikt-Pflanzen, an denen ohne Bestandsschädigung Entnahmen möglich waren. Die systematische Zuordnung hatte ich jeweils überprüft. So habe ich auf meine Weise am Aufbau des „Mainzer Sand im Botanischen Garten der Universität“ mitgewirkt.
Zugute kamen mir insbesondere die speziellen Kenntnisse in systematischer und allgemeiner Botanik, die ich als regelmäßiger Begleiter der pharmazeutischen Praktikanten-Exkursionen meines Vaters, aber auch bei den umfangreichen studentischen Exkursionen der Professoren Troll und Stopp erworben hatte. Ich erinnere mich gerne an die freundlich befehlenden Anweisungen und Fragen von Troll zu Beginn der Excursionen: „Du stehst neben mir!“, „Wo ist dann die Pflanz`?“. Schon einige Jahre vor dem Tod meines Vaters im Jahr 1971 führte ich dann die Exkursionen selbständig fort.
Die meinem Vater und mir bekannten Pflanzenfundorte haben teilweise eine bis ins Mittelalter zurückgehende Geschichte. Zugrunde liegt die Auffindung eines alten Kräuterbuchs. Beim Arbeiten in Landau in den 10er Jahren stieß mein Vater auf ein Kräuterbuch von Hieronymus Bock aus dem 16. Jahrhundert mit genauer Angabe vieler Pflanzenfundorte, auch in der näheren und weiteren Umgebung von Mainz. Mein Vater und später ich haben diese Fundorte überprüft und, zu unserem Erstaunen, waren sie in den meisten Fällen über die Jahrhunderte hinweg erhalten geblieben. Bei späteren Exkursionen und Reisen haben wir die Fundorte fortlaufend ergänzt. Den damaligen Kanzler, Fritz Eichholz, habe ich häufiger auf dem Campus besucht und wir unterhielten uns über studentische Alltagsprobleme.
Bei den Physikern Gerhard Klages und Karl Bechert hörte ich Fach-Vorlesungen. Von Bechert habe ich ein Seminar in Erinnerung, in dem jeder Anwesende physikalische Fragen stellen durfte, auf die er bereitwillig und gut verständlich antwortete.
In Vorlesungen erlebte ich auch den Pharmakologen Prof. Gustav Kuschinsky, der vor seiner Mainzer Zeit Professor in Shanghai und Prag gewesen war und der mit dem Ausspruch „Bei Arzneimitteln ohne Nebenwirkung besteht der Verdacht, dass sie auch keine Hauptwirkung haben!“ noch heute gerne zitiert wird. Wenn ich ihn nach der Vorlesung etwas fragte, beschied er zunächst väterlich „Komm her, Bub!“.
Dem später als deutscher Entdecker einer praktisch anwendbaren und standardisierten Dünnschichtchromatographie bekanntgewordenen Egon Stahl begegnete ich während meiner Studienzeit als Vorlesungsassistent. Mich begeisterten, schon in dieser Frühzeit der Dünnschichtchromatographie, die Schnelligkeit und Direktheit der Ergebnisse hinsichtlich der Zusammensetzung von Pflanzenextrakten. Nach der Habilitation von Egon Stahl war die Nutzung des einzigen der Pharmazie zur Verfügung stehenden Hörsaals nicht ohne Probleme und Stahl hat relativ schnell das Institut zugunsten des Lehrstuhls in Saarbrücken, auf den er berufen wurde, verlassen.
Den Chemiker Fritz Strassmann habe ich in Vorlesungen und in einer abschließenden Prüfung erlebt. Ich fuhr damals mit dem Motorrad und in einem (alten Militär-)Ledermantel zur Universität. Das mir sehr kostbare Besitzstück nahm ich mit in die Strassmann-Vorlesung und legte es immer auf dem Stuhl neben mir in der ersten Reihe. Strassmann begrüßte mich denn auch in der letzten Prüfung: „Sie sind doch der neben dem Ledermantel in der ersten Reihe!“.
Kraftfahrzeuge waren auf dem Campus zu Beginn meines Studiums etwas Seltenes. Es gab zunächst dort nur 2 Motorräder und 3 Autos. Während meines Studiums hat sich die Zahl der Fahrzeuge stark vergrößert. Das Motorrad war auch mein Fortbewegungsmittel bei der Knüpfung internationaler Kontakte. In der Tradition meines Vaters, der 1911 – 1913 in Japan als Apotheker gearbeitet hatte und nach seiner Rückkehr über Korea und mit der transsibirischen Eisenbahn dreizehn Länder bereist hatte, habe ich, während und nach dem Studium viele Auslandsreisen gemacht. Ich besuchte Apotheken in Frankreich, Spanien, den Beneluxländern, Italien, Jugoslawien und Griechenland. Lange vor dem EU-organisierten Studentenaustausch, hatten wir in der Apotheke französische und japanische Pharmazeuten als „Gaststudenten“.
Das besondere Interesse an systematischer Botanik hat mein Leben zu Ende meines Studiums und danach geprägt. Noch während des Studiums führte ich eine Abschlussarbeit über Galium verum und Stachys recta durch, die mit dem Hattingen-Preis ausgezeichnet wurde. Nach Erhalt der Approbation als Apotheker 1959 stand sicher meine ausgedehnte Tätigkeit als Offizin-Apotheker und meine berufspolitische Arbeit im Vorstand von Landesapothekerverein und als Vizepräsident der Landesapothekerkammer im Vordergrund. Ab 1975 habe ich darüber hinaus, drei Jahrzehnte lang, mit zwei Prüferkollegen, die Pharmazieabsolventen im dritten und abschließenden Abschnitt des pharmazeutischen Staatsexamens geprüft. Aber ich fand daneben noch die Zeit, eine „Bibliothek“ alter Kräuterbücher, auch in Fortführung der umfangreichen Sammlung meines Vaters, aufzustellen. Das Studium echter alten Bücher vieler vergangener Jahrhunderte ist sicher mit ein Grund gewesen, dass ich neben dem Lehrauftrag „Medizinische und pharmazeutische Nomenklatur“ über viele Jahre hinweg einen Lehrauftrag über „Geschichte der Naturwissenschaften unter besonderer Berücksichtigung der Pharmazie“ an der Mainzer Universität wahrgenommen habe.
Die Liebe zu Pflanzen hat bei mir auch zu einer zwischen Kunst und Sammeln liegenden Liebhaberei geführt. Zur Abbildung von Pflanzen kann neben zeichnerischen und photographischen Methoden auch der Naturselbstdruck von Pflanzen dienen. Ich habe diese Druckweise seit meinem Studium mit Begeisterung angewandt und verfüge heute über die wohl größte Sammlung von Pflanzenselbstdrucken der Welt. In Japan habe ich acht Jahre lang jährlich Vorträge über Naturselbstdruck gehalten. Ich lernte in Japan sehr berühmte Naturselbstdrucker kennen, die teilweise noch meinen Vater von seinen Vorträgen über Heilpflanzen kannten, aber sich selbst, im Gegensatz zu mir, mit dem Naturselbstdruck von Fischen befassten. Seit 2001 bin ich Ehrenmitglied der „Nature Printing Society“ in Santa Barbara/USA. Naturselbstdruck und alte Kräuterbücher werden bei einem Ausscheiden aus der praktischen pharmazeutischen Tätigkeit einen wichtigen Teil meiner Liebhabereien bilden.
Ich freue mich, die Ursprünge und die großen Etappen im Leben meines Vaters Louis Theodore Kleinmann beleuchten zu dürfen. Ich werde auf seine vom Glauben getragenen Werte, die ihn geleitet haben, und deren Umsetzung eingehen.
Seine persönlichen Erinnerungen an die Feldzüge in Frankreich, Deutschland und Indochina erreichten mich durch seine Korrespondenz mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder René, dem er sich oft anvertraute. Meine aus Brumath stammende Familie hat die Briefe aufgehoben und somit das Andenken an ihren Onkel Louis lebendig gehalten. Dank ihnen war es mir möglich, das Leben meines Vaters in großen Teilen zu rekonstruieren.
Louis war ein zurückhaltender, in sich gekehrter Mensch. Er sprach wenig im Kreise seiner Familie. Außerdem war er als Soldat angehalten, nichts über seine Tätigkeit zu erzählen. Er war aus Berufung Soldat geworden, um seinem Land und den Männern, die ihm anvertraut wurden, zu dienen. Als Journalisten ihn nach seinen Kampferinnerungen fragten, antwortete er ihnen: „Wenn man Krieg geführt und den Tod aus nächster Nähe gesehen hat, dann spricht man wenig darüber.“ Das war seine Art, ihre Anfragen abzulehnen.
Louis wurde 1907 in Brumath im Elsass geboren. Damals gehörte das Gebiet noch zum Reichsland Elsass-Lothringen. Sein Vater war Anstreicher und seine Mutter erledigte den Haushalt für bürgerliche Familien. Er war der älteste Sohn einer armen Familie von fünf Kindern. Er hatte eine Schwester, Hélène (1908-1977), und drei Brüder, Charles (1912-1999), René (1923-2009) und André (1925-1945).
Er wurde von seiner Großmutter aufgezogen, die ihn meistens mit Kirchenliedern in den Schlaf wiegte. Sie starb 1912 als Louis gerade einmal fünf Jahre alt war. Das war ein schwerer Verlust für ihn. Er fühlte sich daraufhin verantwortlich für seine Schwester Hélène und seinen Bruder Charles. Eingezogen von der deutschen Armee, kämpfte sein Vater während des gesamten Krieges von 1914 bis 1918 an der russischen Front. In dieser Zeit musste Louis, trotz seines jungen Alters, seine Familie versorgen. Der Schwarzmarkt, das Betteln und kleinere bezahlte Arbeiten oder Dienste für seine Nachbarn ermöglichten es ihm, ein wenig zum Familienbudget beizutragen. Wenn es ihm die Zeit erlaubte, diente er als Ministrant in der örtlichen Kirche.
Seine Zuverlässigkeit, sein Verantwortungsbewusstsein, sein Fleiß, seine Frömmigkeit und sein tiefer Glaube ermöglichten es ihm, die vielen Schwierigkeiten zu meistern, mit denen er während der Krisen der Nachkriegszeit konfrontiert war. Louis schloss die Mittelstufe in Brumath auf Deutsch ab. Anschließend ging er in Straßburg an die Schule von Ill, das heutige College Louis Pasteur. Hier schloss er im Alter von 18 Jahren erfolgreich die Oberstufe auf Französisch ab.
Im Rathaus von Strasbourg verpflichtete er sich 1926 für drei Jahre zum Dienst in der französischen Armee. Er wurde dem 158. Infanterieregiment zugeteilt. 1930 wurde er an der Militärschule in Saint Maixent aufgenommen, die er als Unterleutnant 1931 abschloss. Von 1933 bis 1934 kommandierte er eine Kompagnie, die im Fort Hackenberg in Weckring, Mosel, stationiert war. Dieses Fort war Teil der Maginot-Linie.
Louis war ein bescheidener Mensch. Wenn er am Wochenende nach Hause zu seiner Familie kam, half er seinem Vater auf dem Feld. Louis sprach perfekt Deutsch und Französisch und studierte von 1935 bis 1936 Germanistik an einer Universität, um seine Kenntnisse über die Kulturen der beiden Länder zu vertiefen.
Im Januar 1938 heiratete er Adrienne Andlauer, die Tochter eines wohlhabenden Eisenwarenhändlers aus Lutzelhouse im Bruchetal. Aus dieser Verbindung gingen vier Kinder hervor: Madeleine (1938–1997), André (geb. 1947), Marie-Hélène (geb. 1949) und Dominique (1954–2019). In den ersten Jahren ihrer Ehe lebten Louis und Adrienne aufgrund des Krieges immer nur für kurze Zeitabschnitte unter demselben Dach.
Louis wurde in der Spionageabwehr ausgebildet und anschließend im Geheimdienst, dem er von 1935 bis 1942 angehörte. Im Januar 1939 wurde Louis zum Capitaine ernannt. Seine Mission war es, ein Maximum an Informationen über die Kommunikation und die Truppenbewegung der Deutschen herauszufinden.
Als die Deutschen 1939 in Frankreich einfielen, war Louis einer der von der Gestapo meistgesuchten französische Offiziere. Er musste mit seiner Familie in die freie Zone nach Lons-Le-Saunier flüchten. Seine Frau und seine kleine Tochter Madeleine blieben während des gesamten Kriegs dort. Louis führte seinen Kampf gegen den deutschen Feind in der Resistance unter dem Namen „Capitaine Kaiser“ fort. Er war verantwortlich für den illegalen Funker in Lons-le-Saunier und arbeitete mit der französischen Widerstandsgruppe „Kleber“ zusammen. Durch Kontakte zu Informanten kam Louis an zahlreiche hochvertrauliche Informationen von größter Wichtigkeit, die er an die Amerikaner zur Auswertung weitergab. Das trug zur erfolgreichen Landung der Alliierten an den französischen Stränden und zur Befreiung Frankreichs bei.
Nach der Niederlage der französischen Armee im Juni 1940 ging Louis in den Untergrund, kam nach Spanien und anschließend nach Portugal. Von dort brach er mit einem Schiff nach Nordafrika auf, wo er sich den freien französischen Streitkräften anschloss. Diese Truppen waren der amerikanischen Armee angegliedert. Louis war also Teil der Befreiungstruppen, die im August 1944 in der Provence landeten. Sie durchquerten das Rhonetal bis in das Elsass.
Ohne Rachegedanken, obwohl er dem gegnerischen Lager angehörte, setzte Louis am Anfang des Jahres 1945 einen Fuß auf deutschen Boden. Im Juli wurde er zum Militärgouverneur der Stadt Mainz ernannt. Seinen ersten Amtsbesuch stattete er dem Bürgermeister der Stadt ab. Er beruhigte die zivilen Behörden, indem er ihnen zusicherte, persönlich darüber zu wachen, dass die französischen Soldaten keine Gewalttaten an der Bevölkerung begingen.
Louis war zutiefst traurig und schockiert über die zu 80 Prozent zerstörte Stadt und die Leiden der Bevölkerung. Er erinnerte sich daran, was er selbst in seiner Jugend als armer Junge einer gebeutelten Familie erlebt hatte. Sein Bruder Charles war von den deutschen Truppen für den Kampf an der russischen Front zwangsrekrutiert worden. Seine Brüder René und André gehörten zur elsässischen Widerstandsgruppe „Die Schwarze Hand“. Sie wurden im Sicherungslager Schirmeck-Vorbruck interniert.
In Mainz traf sich Louis mit deutschen Persönlichkeiten aus dem zivilen und religiösen Leben, die sich dem nationalsozialistischen Regime widersetzt hatten und aus diesem Grund waren im Konzentrationslager Dachau inhaftiert worden waren. Sie hatten diese Hölle überlebt und dabei den französischen Gefangenen angesichts ihrer gemeinsamen Henker geholfen. Das war unter anderem der Fall bei Walter Hummelsheim, Landrat von Bernkastel, und Pfarrer Johannes Brantzen, deren Aussagen uns überliefert sind. Nachdem sie durch die amerikanischen Truppen befreit worden waren, begaben sie sich in das Büro von Louis in der Breidenbacherstraße in Mainz. Sie stießen bei ihm auf ein offenes Ohr. Sie teilten dasselbe Ideal im Kampf gegen die Unterdrückung und waren vom gleichen Wunsch der Versöhnung angetrieben, um die durch den Krieg entstandenen Wunden gemeinsam zu heilen. Im Laufe der Begegnungen entstand eine von gegenseitiger Anerkennung geprägte Freundschaft zwischen ihnen. Sie entdeckten, dass sie vieles gemeinsam hatten, insbesondere das Elsass, wo auch Hummelsheim und Brantzen Familie hatten. Da sich Louis ihnen verbunden fühlte, konnte er die Hand ausstrecken, ihr Vertrauen gewinnen und ihnen helfen, sich sowohl physisch als auch seelisch wieder aufzurichten.
Gutes gegenseitiges Einvernehmen zwischen den zivilen Behörden, der Bevölkerung und den Militärbehörden, die durch Louis vertreten wurden, erlaubte es, Großes zu leisten, woran sich die Stadt Mainz und ihre Universität noch heute erinnern.
Als Stadtkommandant von Mainz mobilisierte Louis all seine Kräfte, seine Dynamik und seine Beziehungen, um der Stadt und ihren Einwohnern zu helfen, sich von den Zerstörungen und Leiden des Krieges zu erholen. Seine Anerkennung hat er sich insbesondere durch den Wiederaufbau der Universität Mainz verdient. Als französischer Offizier ist Louis jedes Risiko angesichts der Kriegsgefangenen eingegangen. Er brachte ihnen Verständnis und Mitgefühl entgegen und gewann ihr Vertrauen. Dadurch konnte er sie motivieren, die Bauarbeiten an der Universität pünktlich zu Ende zu bringen. Letztendlich hat er seine Glaubwürdigkeit und sein Schicksal an diese Männer geknüpft, für die er die Verantwortung trug. Als Zeichen der Anerkennung der von ihnen geleisteten Arbeit erwirkte er die Freilassung der Kriegsgefangenen, nachdem er sich persönlich bei seinen Vorgesetzten für sie eingesetzt hatte. Angesichts des ihm daraufhin zuteilgewordenen Lobs ist er stets bescheiden geblieben. Er verwies stets darauf, dass in dieser von großen Entbehrungen geprägten Zeit „der Wein als Tauschgeld all das ermöglicht habe“. Und auch, als es darum ging, die Bauarbeiten der künftigen Universität voranzutreiben, sah er sich selbst nur als „Fliege an der Kutsche aus der Fabel von La Fontaine“.
Er war sich bewusst, dass seine Taten nur ein Tropfen in einem Ozean der Not waren, die es noch zu lindern galt. Die deutschen Behörden blieben ihm dafür sehr dankbar. Davon zeugen die zahlreichen Titel und Auszeichnungen, die ihm später verliehen wurden. Er blieb Deutschland und seinen Werten, die er teilte, tief verbunden. Er schätzte u. a. ihr Know how und ihre effiziente Organisation, ihre Ernsthaftigkeit und Verbindlichkeit und ebenfalls die ihm entgegengebrachte Freundschaft.
Nach seiner Rückkehr aus Indochina 1955 wurde Louis erneut nach Deutschland versetzt. Von 1956 bis 1958 lebte er mit seiner Familie in Mainz im Osteiner Hof. Von 1959 bis 1969 lebte er mit seiner Familie in Baden-Baden.
Er wurde zum Leiter der Verbindungs- und Koordinierungsgruppe am Hauptsitz der französischen Streitkräfte in Deutschland ernannt und hatte das Amt des Verbindungsbeamten bei den deutschen Behörden inne. Er hielt regelmäßig Vorträge im Rahmen der Ausbildung der Unteroffiziere und Offiziere des Deutschen Verteidigungsamtes, dem Vorläufer der späteren Bundeswehr. Auf Grund dieser Funktion und in Anerkennung seiner herausragenden Verdienste war Louis 1958 der erste ausländische Offizier, der an einem Lehrgang für Generalstabsoffiziere der Direktion für innere Angelegenheiten der Bundeswehr teilnahm. Nach seiner Ernennung zum Oberst wurde Louis zunächst politischer Berater des Obersten Beraters der 1. Französischen Armee.
Unterdessen ernannte ihn der Senat der Johannes Gutenberg-Universität 1961 zum Ehrenbürger in Anerkennung seines Engagements in der Zeit des Wiederaufbaus. Noch bevor Louis 1966 in Rente ging, wurde er für seine Bemühungen um die Deutsch-Französische Verständigung mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
1974 wurde Louis im neuen Rathaus der Stadt Mainz anlässlich eines Empfangs, der zu seinen Ehren abgehalten wurde, begrüßt. Bürgermeister Jockel Fuchs erkundigte sich nach der schönsten Erinnerung, die er mit seinem Aufenthalt in der Stadt verbände. Louis antwortete ohne zu zögern: „Die Mainzer Bevölkerung selbst“. Die Mainzerinnen und Mainzer hatten Louis also zu Recht „Einen Vater für die Stadt“ genannt.
Mehrere von der Universität Mainz veröffentlichte Artikel setzen sich mit dem Ende seiner Karriere auseinander, nachdem Louis Mainz verlassen hatte. Ich erlaube mir, Folgendes an dieser Stelle hinzuzufügen:
Nach seiner Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz lehnte er in einem Geiste der Selbstaufopferung das Angebot ab, zum General und militärischen Berater des französischen Konsuls in Bad Godesberg befördert zu werden. Sein Gesundheitszustand, der sich durch die Kämpfe in Indochina dramatisch verschlechtert hatte, hatte dies nicht zugelassen. Er wollte seine letzten Kräfte seiner Familie zukommen lassen, der er mit der Großzügigkeit, der Gutmütigkeit und der Liebe, die man von ihm kannte, gedient hatte.
Selbst nachdem er 1969 bereits im Ruhestand war, fand Louis Freude daran, auf der eigenen Erfahrung aufbauend, Konferenzen in Deutschland über den nachhaltigen Frieden beider Länder abzuhalten. Damals ging er wie zum Frischeluftschnappen in das Land, das er so liebte. Nicole Güth von der Universität Mainz interviewte ihn und veröffentlichte 1985 einen Artikel unter dem Titel: „Ein Herz in Uniform.“
Dieses Herz schlug nach seiner Mainzer Zeit weiter, empfänglich für das Leiden der Bevölkerung in Indochina. Aus idealistischen Motiven heraus meldete er sich freiwillig, um den Vormarsch der kommunistischen Truppen in Südostasien zu bekämpfen.
1954 wurde er nach Korea versetzt. Ein Jahr später kam er mitten im Indochinakrieg nach Saigon. Auch dort zeichnete er sich in heftigen Gefechten an Seiten seiner Truppen aus, von denen er einen Großteil rettete, weil er sie durch den Urwald führte. Er selbst wurde mehrmals verwundet. Sein heldenhafter Einsatz brachte ihm mehrere Orden ein.
Nach der Unterzeichnung des Genfer Abkommens 1954, das den Kämpfen ein Ende setzte, schrieb Louis seinem Bruder René: „Bevor ich nach Frankreich zurückkehre, muss ich noch ein Jahr in Vietnam bleiben. Am ersten September wurde ich zum Kommandanten in Quang Tri im Norden von Hue am 17. Breitengrad ernannt. Dieser Bereich umfasst die komplette Demarkationslinie zwischen den Viet Minh und Vietnam. Dieser Posten gefällt mir. Theoretisch bin ich der einzige Kommandant meines Territoriums, der Sektor Quang Tri steht unter meinem Befehl. Quang Tri ist ungefähr 3000 Quadratkilometer groß, das entspricht der Hälfte eines französischen Departements. Hier gibt es tatsächliche territoriale Einheiten, ebenso wie andere Bataillone der französischen Armee. Ich kenne einige ihrer Kommandanten, die ich im Rahmen von Feldzügen in Frankreich kennengelernt hatte. Hier befehlige ich hauptsächlich vietnamesische Bataillone.
Ich habe ein Programm zur Instandsetzung der Straßen und Pfade, zum Bau von Brücken und Übergängen auf die Beine gestellt, damit der Verkehr wieder rollt, in diesen ohnehin schon verarmten Regionen, die durch acht Jahre Krieg noch ärmer geworden sind. Hier gibt es eine Region, die am Meer liegt und sich über sechs bis zehn Kilometer erstreckt mit einem Sand- und Dünenküstenstreifen. Hier sind die Reisfelder mager und die Menschen halb Bauern, halb Fischer.
Die Viets waren die unangefochtenen Herren dieser Region, die man betrüblicherweise unter dem Namen „Straße ohne Freude“ kennt. Es gibt eine Reihe von Dörfern, die seit acht Jahren quasi keinen Arzt zu sehen bekommen haben, viel Leid, das es zu heilen gilt und ich bringe mich ein. Ich konnte insbesondere an Waisenhäuser Kleidung und Lebensmittel verteilen, die aus den mir übertragenen überschüssigen Vorräten der amerikanischen Armee stammen.
Ich arbeite Hand in Hand mit den vietnamesischen Behörden, deren Leiter ein noch junger Mann ist. Es handelt sich um einen ehemaligen Viet Minh-Kommandanten und eine beeindruckende Persönlichkeit. Es ist übrigens bemerkenswert, festzustellen, wie viele konvertierte ehemalige Angehörige der Viet Minh viel mehr Einfluss haben und viel dynamischer sind als die vietnamesischen Behörden, insbesondere die aus dem Süden, die sich wie schwache und korrumpierte Funktionäre verhalten.
Unter meinem direkten Befehl stehen ein halbes Dutzend Unteroffiziere und etwa hundert Männer, außerdem zwei vietnamesische Bataillone und fünf Hilfskompanien. Es gibt etwa einhundert Lager, Posten, Blockhäuser und Wachtürme. Ich habe die meisten geschlossen. Anfang des Jahres 1955 habe ich die Auflösung des französischen Sonderkommandos von Quang Tri dirigiert. Dann habe ich mich nach Touran weiter im Süden begeben.“
Am 11. Juli 1955 reiste Louis zurück nach Frankreich. Die überlebenden Offiziere des 2. Koreabataillons lobten einstimmig seine Charaktereigenschaften. „Misele, die kleine Maus“, wie ihn seine elsässischen Kameraden liebevoll nannten, bestach durch ein lebendiges Naturell und starke Überzeugungen. Dieser kleine, einfache Mann, der ein bescheidenes Leben führte, kontrastierte mit dem Kommandanten Tourbet, des berittenen Kommandanten des 1. Koreabataillons und mit dem Kommandanten Barrou. Er demonstrierte seinen Mut „indem er sich schnell an den Ort des Geschehens begab, ohne sich um die Risiken zu sorgen, dort wo eine Einheit im Einsatz war…“ und er bewies seine Hartnäckigkeit während der dunkelsten Tage des Indochinakriegs. General G. Journet schrieb: „Er war ein guter Diener Frankreichs und ein guter und aufrichtiger Mann.“
So wie Louis in einem seiner Indochinabriefe an seinen Bruder René geschrieben hatte: „Wenn ich während der Schlacht von Anke noch am Leben bin, dann nicht nur dank eines Wunders, sondern dank einer Vielzahl an Wundern.“
Louis Großmutter, Marie Ebel, hat ihm einen tiefen Glauben weitergegeben, den er sich sein ganzes Leben behalten hat. Er besuchte ihr Grab regelmäßig, wenn er auf Fronturlaub in der Heimat war. Als er in Rente ging, hat er seinen Glauben auch praktiziert. Er nahm regelmäßig an den Pilgerfahrten von Marienthal und Hohatzenheim im Elsass teil. Er war auch eines der Fördermitglieder der Benediktinerklöster Maria-Laach und Beuron.
Im Laufe seiner gesamten brillianten Karriere hat Louis nie versucht, persönliche Besitztümer anzuhäufen. Gezeichnet von einer langen Krankheit starb er am 14. Juli 1979 im Alter von 72 Jahren. Und auch in seinem letzten Willen äußerte er den Wunsch, die komplette Kollekte seiner Beerdigung an ein vietnamesisches Waisenhaus zu senden, das er durch Spenden unterstützt hatte.
Damals war seiner Familie das Ausmaß der Aufgaben, die er erfüllt hatte, nicht bewusst. Heute und mit meinen dürftigen Worten möchte ich ihm sagen: „Danke und gut gemacht, Papa. Du hast die Aufgabe erfüllt, die dir für deine Zeit auf Erden aufgetragen wurde.“
Louis ruht an der Seite seiner Ehefrau Adrienne und seines jüngsten Sohns Dominique, der ihnen im September 2019 gefolgt ist, im Familiengrab auf dem Friedhof in seiner Heimat Brumath.
Der auf dem Mainzer Universitätscampus befindliche Weg, der am 23. Mai 1985 „Colonel-Kleinmann-Weg“ getauft wurde, soll künftige Generationen an sein Engagement und seine Werte erinnern.
Quellen und Literatur:
- Colonel Louis Kleinmann, erzählt von seinem Bruder René.
- André, Marc: Louis Kleinmann, un Brumathois en Indochine. In: Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Brumath 25 (1997), S. 10–17.
- [o. V.]: Ein Mann der ersten Stunde: Colonel Louis Kleinmann. In: Jogu 13 (1985), Nr. 97, S. 18–22.
- Schütz, Friedrich: Louis Théodore Kleinmann (1907–1979). Französischer Stadtkommandant von Mainz 1945/46: der „Vater der Stadt“. In: Kißener, Michael/Mathy, Helmut (Hrsg.): Ut omnes unum sint. Gründungspersönlichkeiten der Johannes Gutenberg-Universität. Bd. 2. Stuttgart 2006 (Beiträge zur Geschichte der Universität Mainz, N. F. 3), S. 9–21.
- Güth, Nicole: Herz in Uniform. In: Jogu 4 (1974), Nr. 33, S. 5.
- Ich musste wieder viel gutmachen. Pfarrer Brantzen über seine Begegnungen mit dem früheren französischen Stadtkommandanten. In: AZ, 22.8.1979.
Mein später Studienbeginn zu Beginn der 50er Jahre war vor allem durch Kriegsereignisse verursacht. Dazu kamen Schulaufnahmetermine und Schuljahresumstellungen, bei denen sich die „Ungnade der späten Geburt“ (im Juli 1928) auswirkte.
Mein Heimatort Straelen am Niederhein liegt nur wenige Kilometer von der holländischen Grenze entfernt. Nach dem schnellen Vormarsch der alliierten Truppen wurden die Schulen im Spätsommer 1944 geschlossen. Als Schüler wurden wir im sogenannten „Fronteinsatz West“ eingesetzt, um Panzer- und Schützengräben auszuheben und Kurierdienste für Wehrmachtsstäbe zu machen. Dabei wurden wir häufig von feindlichen Tieffliegern beschossen. Schon anderthalb Jahre vorher war ich von der Stadtverwaltung als Polizeimelder berufen worden. Wir mussten im Bunker neben dem Rathaus Telefonverbindungen schalten, Einsatzbefehle der Feuerwehr und der Luftschutzorgane weitergeben, Sirenen schalten und – wenn der Strom ausfiel – hin und wieder mit der Handsirene durch die Straßen laufen. In der Einflugschneise der angloamerikanischen Bomber wohnend, waren wir fast ständig im Einsatz, versuchten aber trotzdem pünktlich zur Schule zu kommen. Der Zug zur Schule wurde häufig von Jagdbombern beschossen, so daß wir schließlich einen Wagen mit Flak angehängt bekamen.
Als im Frühjahr 1944 eine Musterung zur Waffen-SS angekündigt wurde, habe ich mich freiwillig als Offiziersbewerber zur Kriegsmarine gemeldet; im Spätherbst wurde ich zu einer vormilitärischen seemännischen Ausbildung als Offiziersbewerber der Marine nach Glücksburg einberufen. Dort war ich anschließend als Hilfsausbilder tätig, nachdem ich, wenige Tage vor Weihnachten, nach einer dreitägigen strengen Prüfung in Stralsund, endgültig als Offiziersbewerber der Marine angenommen worden war. Meinen Truppenteil am Marinestandort Waren/Müritz habe ich wegen der Kriegsereignisse im April 1945 nicht mehr erreicht. Ich erwähne diese Begebenheit so ausführlich, weil ein bedeutender Schriftsteller vor einiger Zeit von einer ähnlichen Situation berichtete, die allerdings nicht so glücklich verlief.
Zum Studium nach Mainz kam ich, weil der Andrang zum Medizinstudium zu jenem Zeitpunkt besonders groß und im bevölkerungsreichsten Land NRW die Universitäten Köln/Bonn und Münster (in Düsseldorf nur klinische Semester) völlig überfüllt waren; für das Fach Medizin bestanden dort Wartezeiten. Mainz wurde mir von Bekannten empfohlen, da dort die Anzahl der Studenten gering und die „Hörsäle halbleer“ seien. Tatsächlich waren damals in Mainz nur wenig über 3000 Studenten immatrikuliert. Überfüllte Hörsäle habe ich dann erst später in Bonn erlebt. Zur Bewerbung um einen Studienplatz für Medizin war eine Vorstellung beim Dekan der Medizinischen Fakultät erforderlich und das war damals Professor Kliewe, ein sehr freundlicher und sympathischer Mann, zu dem man beim Vorstellungsgespräch in kurzer Zeit sehr großes Vertrauen gewann.
Mainz war zu dieser Zeit sicherlich kein begehrenswerter Studienort. Die Stadt war total zerstört und man konnte über die Trümmer hinweg von der Kaiserstraße bis zum Dom sehen. Schwerste Zerstörungen gab es auch in anderen deutschen Städten, aber während dort schon fleißig geräumt worden war und etwas vom Wiederaufbau zu spüren war, tat sich in Mainz doch recht wenig. Man sagte damals, an dieser Stagnation sei die französische Besatzungsmacht schuld. Ich, der ich aus der damaligen britischen Zone kam, glaubte aber auch einen Mangel an Motivation zu erkennen. Anders an den Gebäuden der Universität: Die Schäden an der ehemaligen Kaserne, die von Bomben weitgehend verschont geblieben war, wurden insbesondere durch den Einsatz von Studenten bald beseitigt und es wurden durch Umbauten die Voraussetzungen für einen universitären Lehrbetrieb geschaffen. Es fehlte aber der „Geruch“ einer Universität und im Geiste hörte man an vielen Stellen noch das Getrampel von „Knobelbechern“. Wie ein relativ moderner Kasernenbau so ist – er war ja erst im Krieg erstellt worden – war alles sehr nüchtern und schmucklos. Etwas netter war die „Taverna“, ein ehemaliges Offizierskasino. Dort gab es sogar weiß gedeckte Tische, und man konnte nach einer Speisekarte bestellen. Wegen der Preise konnte man sich das aber nur gelegentlich leisten. In der Mensa gab es nur ein Einheitsessen und das war sehr einfallslos. In der Hauptsache ernährten wir uns mit einer Flasche Milch und einem trockenen Brötchen.
In den ersten Jahren waren die Einwohner der Stadt den Studenten auch nicht besonders freundlich zugetan. Sie waren es ja nicht gewohnt, Universitätsstadt zu sein und mit Studenten zu leben. Wir spürten an allen Ecken, dass wir als Fremdkörper empfunden wurden. Daß die Universität ein Aushängeschild und ein Wirtschaftsfaktor sein könnte, haben die Mainzer lange nicht erkannt. Eine Universitätsstadt, von der unsere Väter schwärmten, gab es zu der Zeit nicht. Dazu brauchte es noch viele Jahre.
Natürlich war die Lage auf dem Wohnungsmarkt denkbar schlecht. Wegen der Zerstörungen konnte man in der Stadt selbst kaum eine Wohnung bekommen. Man musste also in die Vororte oder aufs Land, wo viele Studenten froh waren, ein Dach über dem Kopf zu haben, aber teilweise mit Waschgelegenheit und „Plumpsklo“ über den Hof. Es gab natürlich auch ein paar komfortablere Wohnungen. Aber die waren dünn gesät und teuer; der Preis spielte so kurz nach der Währungsreform doch eine erhebliche Rolle. Solche Wohnungen wurden in der Regel auch nur unter Freunden und Verwandten weitergeben. Ich hatte Glück und fand eine Wohnung in einem umgeräumten Wohnzimmer eines Einfamilienhauses im Grünen in Kostheim-Siedlung bei einer fürsorglichen Wirtin, die gegen einen Unkostenbeitrag von 1 DM eine vorzügliche italienische Pasta zubereitete. Und außerdem erwartete sie von mir, am Abend eine Partie Canasta mit ihr zu spielen, was ich natürlich erstmal lernen musste. Aber es ab ein Verkehrsproblem. Die letzte Straßenbahn fuhr um 21 Uhr, die Anschlußverbindungen waren denkbar schlecht. Da ich nicht immer Canasta spielen und auch mal an einem Verbindungsleben teilnehmen wollte, bin ich dann doch schnell wieder auf die linke Rheinseite gewechselt. Nach zwei Fehlversuchen und einem kurzen Abstecher nach Bonn, von dem ich aus Sehnsucht nach meiner jetzigen Frau zurückkehrte, habe ich durch einen Studienfreund auch eine der begehrten Wohnungen gefunden.
Die Vorlesungen in den vorklinischen Semestern liefen in einem eher schulmäßigen Rahmen ab, was wohl auch der damaligen Zeit entsprach. Seit Kriegsende und seit der Wiedergründung der Universität waren nur wenige Jahre vergangen. Viele Professoren kamen aus den deutschen Ost-Gebieten und mussten sich hier fast gleichzeitig zu einem Lehrkörper zusammen finden und in der zerstörten Stadt eine einigermaßen adäquate Wohnung suchen. Zu dieser Zeit mangelte es ja noch an allen Enden. Aber es waren sehr gute Lehrer, die nach Mainz gekommen waren: Prof. Dabelow in Anatomie I, II, III etc. Entwicklungsgeschichte und Histologie bei Prof. Watzka, einem bemerkenswerten Mann. Die beiden Präparierkurse fanden wegen der Temperaturen nur im Winter statt und zwar im Dachgeschoß des Anatomischen Instituts, wo es dann auch wirklich kalt war. Aber wir waren zu dieser Zeit ja noch ziemlich abgehärtet. Montags tränten uns ständig die Augen, nachdem die zu präparierenden Objekte über das Wochenende im Formalinbad gelegen hatten. Eine gute Bekannte kann seit dieser Zeit keinen Tafelspitz mehr essen. Die vor jedem Wochenende fälligen Testate wurden von Assistenten aber auch von Hilfsassistenten abgenommen, wobei letztere sich häufig darstellen wollten und die Kursteilnehmer entsprechend „zwiebelten“. Physiologie habe ich bei Prof. Schriever und Physiologische Chemie bei Prof. Lang gehört. Sehr interessant, weil lebhaft und praxisnah war das physiologische Praktikum von Prof. Kreienberg. Prof. Klumb hielt die Vorlesungen und Praktika in Physik, Prof. Troll die in Botanik. Prof. Strassmann sahen wir als freundlichen Nobelpreisträger und freuten uns an seinen interessanten Chemievorlesungen. Das Vorphysikum, bei dem man die naturwissenschaftlichen Prüfungen nach 2 – 3 Semestern vorwegnehmen konnte, war zu unserer Zeit gerade abgeschafft worden. So mussten wir im Physikum alle Fächer innerhalb einer Woche ablegen, das waren 2 Prüfungen täglich. Als Studenten hätten wir schriftliche Prüfungen lieber gesehen, denn nicht jeder ist ein ruhiger Prüfungstyp und nicht jeder Professor ein geschickter Prüfer. Bei den studentischen Kolleginnen – zur damaligen Zeit gab es nur wenige – kursierte ein Skript mit Notizen wie beispielsweise „bei Prof. X Lippenstift empfohlen, bei Prof. Y auf keinen Fall“. Die klinischen Semester verliefen in Mainz eigentlich ohne Besonderheiten. Obwohl das „Städtische Krankenhaus“, noch lange Jahre in Mainz das „Städtische“ genannt, erst bei der Wiederbegründung der Universität zur Universitätsklinik erhoben worden war, hatte diese damals schon einen sehr guten Ruf und war mit ausgezeichneten Lehrkräften besetzt: Innere Medizin mit den Prof. Voigt und Duesberg, Chirurgie mit Prof. Brand, Pathologie mit Prof. Klinge, Hygiene und Bakteriologie mit Prof. Kliewe, Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Prof. Schwalm, Haut mit Prof. Keining, Augenheilkunde mit den Prof. Jess und Wagner, Psychiatrie mit Prof. Kranz, Gerichtsmedizin mit Prof. Wagner, Hals-Nasen-Ohren mit Prof. Leicher. Oberärzte mit teilweise sehr gutem Vortrag waren die Prof. Burkhard, Gros und Friedberg. Besonders interessante Persönlichkeiten, aber im Staatsexamen gefürchtet waren Prof. Kschinsky (Pharmakologie) und Prof. Köttgen (Kinderheilkunde). Etwas Pech hatte ich mit meiner Doktorarbeit. Mein Doktorvater, den ich auf Empfehlung meines späteren Schwiegervaters gewählt hatte, überredete mich zu einer experimentellen, viel Zeit kostenden Arbeit. Die zu untersuchenden Leberkranken wurden oft sofort von der Klinik in Sanatorien oder in Versorgungskuranstalten (Spätheimkehrer aus der Gefangenschaft) verlegt und waren dann bisweilen nicht mehr erreichbar.
Da mein Vater CVer war, versuchte ich schon im ersten Semester entsprechende Kontakte zu Verbindungen zu knüpfen. Schließlich entschied ich mich für die CV-Verbindung Rhenania-Moguntia, wo ich dann auch mehrere Chargen bekleidete. Das Verbindungsleben war damals weit entfernt von der vielbesungenen Burschenherrlichkeit. Farben durften in der Öffentlichkeit nicht getragen werden und die große Mehrheit der Studenten lehnte die Verbindungen, auch die katholischen und insbesondere die farbentragenden, als reaktionär ab. Da es in Mainz keine studentische Tradition gab, hatten wir keine Unterstützung durch die Bevölkerung. Verbindungshäuser gab es nicht und wir mussten in der noch schwer zerstörten Stadt die Räume für Veranstaltungen oft wechseln. Den Unterschied eines Verbindungslebens konnte ich erkennen, als ich nach dem Physikum ein Semester in Bonn verbrachte und dort Gast bei der CV-Verbindung Bavaria war mit einem schönen Verbindungshaus und einem Hausmeisterehepaar, das, dank einer spendefreudigen Altherrrenschaft, mit täglichem Mittagessen für das Wohl der Studenten sorgte.
Trotzdem habe ich die Studentenzeit in Mainz genossen. Man lebte in einer Zeit des Aufbaues nach dem Krieg und freute sich über jede auch noch so kleine Verbesserung. Da unsere Eltern unser Studium bezahlen mussten, sahen wir uns auch in der Verpflichtung dem gerecht zu werden. Nur weil ich bereits 1953 eine Mainzer Jurastudentin kennen lernte, die heute meine Frau ist, habe ich auch den Rest meines Studiums in Mainz absolviert.
Vom Abenteuerspielplatz zum Home Office
Eine persönliche Zeitreise durch die Mainzer Universitätsgeschichte
Wenn die Johannes Gutenberg-Universität im Mai 2021 den 75. Jahrestag ihrer (Wieder-)Gründung feiert, sind es gut fünf Jahrzehnte, in denen ich selbst sie aus der Nähe habe miterleben können. Ja, länger noch, falls man zeitliche Lücken dazwischen nicht ausklammert. Ich bin nämlich in verschiedenen Altersstufen und Rollen mit ihr verbunden gewesen (und bin es noch): als Schulkind, Student, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Professor und heute „Emeritus“. Dabei konnte ich beobachten, wie stark sich die Universität veränderte: von einer anfangs überschaubaren akademischen Bildungseinrichtung für wenige zu einer großen Massenuniversität. Spaziere ich heute über den Campus, so fällt es mir schwer, im Kopf den status quo ante, wie die Historiker sagen, auszublenden.
Zum ersten Mal gesehen habe ich Mainz und seine Universität im Januar 1951. Diese verfügte damals schon über ein eigenes Hochbauamt, und mein Vater war zu dessen Leiter bestellt worden. Wir kamen aus Trier, von wo er als Beamter nach Mainz versetzt worden war. In den ersten Januartagen zogen wir dorthin um. Ein eigenes Auto hatten wir noch (lange) nicht, durften aber einen alten VW aus dem Fuhrpark der Universität nutzen. Wegen starken Schneefalls konnten wir nicht die Strecke über die Hunsrückhöhenstraße nehmen, sondern mussten den windungsreichen Weg an der Mosel bis Koblenz und dann am Rhein entlang wählen. Das war eine Anreise mit Hindernissen.
Als wir die Universität erreichten, lag auch auf dem Campus Schnee. Wir – meine Eltern, meine zwei älteren Brüder und ich – bezogen eine holzverkleidete Baracke auf dem Universitätsgelände. Diese war äußerlich unansehnlich, im Innern aber einigermaßen geräumig. Allerdings war der Komfort bescheiden. Wir hatten weder Kühlschrank noch Badewanne und mussten, wenn wir baden wollten, jede Woche zu diesem Zweck Kellerräume am Forum aufsuchen. Wo Badewannen wahrscheinlich noch aus Militärzeiten benutzt werden konnten. Im Souterrain gab es dort sogar noch einen Friseur. In der Ladenzeile am Eingang zur Universität, der ehemaligen Wache, konnte man noch Lebensmittel für den täglichen Bedarf einkaufen, daneben im Papiergeschäft meine Schulhefte und in der Buchhandlung die Schulbücher oder anderen Lesestoff. Selbst das Tabakgeschäft war von Bedeutung, weil wir Kinder uns aus Zigarettenschachteln ein Kartenspiel herstellten, bei dem die Marke „Mercedes“ (die gab es wirklich!) Trumpf war und „Overstolz“ oder „Mokri“ das Normalblatt. Den markanten Torturm der Flak-Kaserne nannten wir übrigens „Ata-Flasche“, weil er so aussah wie die Verpackung des bekannten Scheuermittels. Die Verbindung zur Stadt stellte die alte Straßenbahnlinie 2 her.
Auf dem Campus wohnten noch andere Universitätsbedienstete, mit deren Kindern wir uns ziemlich frei auf dem noch unverbauten Universitätsgelände herumtreiben konnten. Zusammen feierten wir jeweils Kindergeburtstag. Besonders liebten wir das kleine Wäldchen, dessen Reste heute noch zwischen dem Haus Recht und Wirtschaft und der Universitätsbibliothek vorhanden sind. Wir bauten Zelte und Baumhäuser, spielten Räuber und Gendarm und Verstecken. Es war ein rechter Abenteuerspielplatz, noch ohne kindgerechte Schaukeln, Rutschen und dergleichen. Zur Volksschule mussten wir nach Zahlbach, wo der gleichnamige Bach noch sichtbar und nicht überbaut war. Der Weg führte an den Römersteinen und an Schrebergärten entlang, wo wir gern herumtrödelten.
Damals lag die Zahl der Studierenden bei knapp 5000, überwiegend männliche, knapp ein Drittel waren Frauen. Sie kamen uns Kindern oft ziemlich alt vor. Das hatte damit zu tun, dass viele Männer im Krieg und in Gefangenschaft gewesen waren oder ihr Studium hatten unterbrechen müssen. Sie wohnten in Studentenheimen im Dachgeschoss am Forum, aber auch in anderen Baracken, so wie wir. Auffälliger Weise studierten in Mainz damals viele Perser, wie man noch sagte, und zwar Medizin. Sie spielten bemerkenswert gut Handball, wie man auf dem Sportplatz beobachten konnte. Das war die Zeit, in der in ihrem Heimatland noch der Schah mit seiner schönen Frau Soraya regierte.
Was auf einer Universität alles so ablief, blieb uns Kindern natürlich weitgehend verborgen. Das eine oder andere erfuhren wir durch unseren Vater. Wir wussten jedenfalls, dass die Universität von einem Rektor und einem Kurator geleitet wurde, zwischen denen es offenbar Konflikte gab. Von Vorteil war, dass der letztere der gleichen Studentenverbindung in München angehört hatte wie unser Vater. „Bundesbrüder“ waren einander in der Regel freundschaftlich gewogen, das galt auch in diesem Fall. So erhielten wir – was später kaum mehr möglich gewesen wäre – die Erlaubnis, den alten universitätseigenen VW-Käfer am Wochenende für private Ausflüge in den Taunus und in den Odenwald zu nutzen. Dort wanderten wir umher, bewunderten die Naturschönheiten und machten Picknick. Der Kurator hatte eine ziemlich bärbeißige Art und scheint den Professoren nicht immer respektvoll begegnet zu sein. Als einer von ihnen ihn gelegentlich wegen eines Begehrens aufsuchte, entfuhren diesem angeblich die Worte: „Was will denn dieses Kamel schon wieder.“
Gelegentlich durfte ich meinen Vater in seinem Büro besuchen, das sich in dem kleinen, noch heute erhaltenen Flachbau am Nebeneingang zur Universität an der Albert Schweitzer-Straße befand. Noch wurde von den Gebäuden der Universität mehr instandgesetzt als neu errichtet. Ich weiß auch noch, dass der Vater eines Abends verständigt wurde, er müsse dringend in die Stadt kommen. Dort war bei einem Sturm ein Teil des Dachreiters der alten Domus Universitatis, die gerade wieder aufgebaut wurde, heruntergeweht worden. Aus Kostengründen musste man sich seinerzeit mit einem einzigen begnügen, zwei historisch verbürgte wurden erst später bei einer Renovierung draufgesetzt.
Dieses irgendwie paradiesische Leben dauerte dreieinhalb Jahre, bis 1954. Zu diesem Zeitpunkt war mein Vater bereits erneut versetzt worden, und zwar zum Staatlichen Hochbauamt in Speyer, wohin die Familie ihm zu Ostern 1954 folgte. Zuvor hatte ich noch, wie das damals üblich war, die Aufnahmeprüfung für die Höhere Schule am Gymnasium am Kurfürstlichen Schloss abgelegt, in dem meine Brüder in den Mainzer Jahren unterrichtet worden waren.
Als es hieß, von Mainz Abschied zu nehmen, schmerzte mich dies sehr. Neun Jahre habe ich dann das Neusprachliche Gymnasium in Speyer besucht, ein Ort, den ich im Vergleich zu Mainz als ziemlich kleinstädtisch empfand. Dort machte ich 1963 mein Abitur. Damit rückte die Frage in den Vordergrund, welchen Beruf ich ergreifen sollte. Ich hatte schon als Kind viel gelesen und geschrieben, was den Journalistenberuf naheliegend erscheinen ließ. Zwar konnte und kann man diesen Beruf auch ohne Hochschulstudium anstreben, doch haben dazu nur diejenigen geraten, die selbst keines hatten. Von Speyer aus gesehen, hätte Heidelberg mit seiner alten Universität am nächsten gelegen. Aber ich entschied mich für Mainz. Die Verbindungen waren ohnehin nicht abgerissen, weil das Hochbauamt in Speyer für den Ableger der Universität in Germersheim mit seiner Dolmetscherausbildung zuständig war.
So kehrte ich im Sommersemester 1963 als Student nach Mainz zurück, das ich ja gut kannte. Zum ersten Semester bezog ich ein Zimmer im Mainzer Kolleg, einem Studentenwohnheim just an der Stelle, an der sich zehn Jahre zuvor unsere Baracke befunden hatte, die inzwischen abgerissen worden war. Selbstverständlich fühlte ich mich auf dem Campus gleich wieder wie zuhause. Als Neuling musste man erst einmal mit einem Platz in einem Doppelzimmer Vorlieb nehmen, wie überhaupt im Mainzer Kolleg auf gemeinschaftsbildende Aktivitäten Wert gelegt wurde. Das war für die Nachkriegszeit typisch. Studentinnen und Studenten wohnten – schon wegen der Gemeinschaftsduschen – auf getrennten Fluren, die Flurküchen konnte man, wenn man wollte, zusammen nutzen.
Nach einigen Unsicherheiten, was ich studieren sollte, entschloss ich mich für Germanistik als Hauptfach. Als Nebenfach wählte ich Kunstgeschichte, weil es mich offenbar ins Kulturessort zog. Meine Hauptlehrer waren der Germanist Paul Requadt und der Kunsthistoriker Friedrich Gerke, ein recht barocker Typ, legendär für seine Sommerfeste im nahen Ingelheim. Überdies gab es in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ein kleines Angebot in „Zeitungswissenschaft“. Genau das schien mir passend. Dieses Angebot – ein eigenes „Fach“ war dies noch nicht – wurde von Heinrich Tötter, dem seinerzeitigen Chefredakteur der Mainzer Allgemeinen Zeitung bestritten. Es bestand aus einer Vorlesung und einem Seminar oder einer Übung, die Tötter bevorzugt mit Schilderungen aus seiner praktischen Berufserfahrung bestritt.
Daran änderte sich erst etwas, als 1964 ein Lehrstuhl für Publizistik neu eingerichtet und die Allensbacher Demoskopin Elisabeth Noelle-Neumann auf diesen berufen wurde. Ich gehörte zu ihren ersten Studenten. Für uns bedeutete ihr Erscheinen einen Schock. Denn bis dahin hatten wir kritisch über Journalismus räsoniert. Sie aber importierte die uns bis dahin völlig unbekannten empirisch-quantitativen Forschungsmethoden. Diese erforderten ein Umdenken. Mit ihr begann in der Bundesrepublik die sozialwissenschaftliche Wende in der Publizistikwissenchaft, für welche die so genannte „Mainzer Schule“ führend war.
Auf dem Campus zu wohnen, hatte seinen Vorteil vor allem durch die kurzen Wege. In den zeitlichen Lücken zwischen den Veranstaltungen konnte ich rasch wieder nachhause gehen. Das hatte allerdings den Nachteil, dass man weniger in Kontakt zu Kommilitoninnen und Kommilitonen kam. So entdeckte ich erst verspätet, welche Arbeitsmöglichkeiten die Institute mit ihren Bibliotheken boten. Das Deutsche Institut lag am Forum und dort fanden auch die Vorlesungen und Seminare statt. Das Kunsthistorische Institut aber hatte seit Anfang der 1960er Jahre ein eigenes Gebäude am Binger Schlag (neben dem Musikinstitut), das vor einigen Jahren wieder abgerissen worden ist, um einer Wohnanlage für Studierende Platz zu machen. Das Institut für Publizistik war auf dem Campus zunächst in einem ehemaligen Gebäude mit Privatwohnungen am Jakob Welder-Weg untergebracht und dehnte sich, je größer es wurde, vom Dachgeschoss bis zum Parterre aus. Die Dienstzimmer waren früher Küche, Schlafzimmer oder Wohnzimmer gewesen und dafür auch konzipiert worden. Im gleichen Haus befanden sich anfangs noch Teile der Universitätsbauleitung. Auch dieses Gebäude ist jüngst durch einen schicken Neubau ersetzt worden.
Für meine Fächerkombination gab es damals keine Abschlussmöglichkeit außer der Promotion. Ein Staatsexamen wie in Lehramtsstudiengängen war nicht vorgesehen, ja die Magisterprüfung existierte noch gar nicht. So blieb mir kein anderer Weg, als eine Doktorarbeit zu schreiben. Das geschah nicht frei von Sorgen, denn falls dies nicht erfolgreich gelingen würde, stünde ich ohne einen Hochschulabschluss da. Zum Glück trat dieser Fall aber nicht ein, ja der stufenlose Weg wirkte sogar beschleunigend, so dass ich mit 27 Jahren bereits promoviert war. Lediglich ein Semester zwischendurch war ich an die Universität Münster „emigriert“, um zumindest einmal woanders akademische Luft zu schnuppern. Ich kehrte aber nach einem Semester bereits nach Mainz zurück, weil ich in Münster nicht nochmals „Scheine“ machen wollte, die ich schon erworben hatte. Das hätte mein Studium nur unnötig verlängert.
Als Doktorvater hatte ich mir Paul Requadt ausgesucht, der mich als Student am meisten inspiriert hatte; und als Thema eine literarische Form, die durch Aktualität und Öffentlichkeitsbezug ausgezeichnet war (das „Zeitgedicht“). Es ging dabei nicht nur um Ästhetik. Diese Wahl war gewiss auch durch die Zeitumstände Ende der 1960er Jahre bedingt, als die gesellschaftliche Politisierung voranschritt und die Studentenbewegung die Universität(en) eroberte. Sehr viel davon habe ich allerdings nicht mitbekommen, da ich keine Lehrveranstaltungen mehr besuchte und meine Dissertation mich zu zurückgezogener Arbeit, ja zur Einsamkeit zwang. Aber ich wurde Anfang 1971 doch Zeuge der legendären Besetzung des Instituts für Publizistik durch linke studentische Aktivisten und ihrer massiven Angriffe auf Elisabeth Noelle-Neumann, die Institutsleiterin.
In den 1960er Jahren begann die Universität zu expandieren. Die Zahl der Studierenden stieg an, eine rege Bautätigkeit setzte ein. Für die Naturwissenschaft entstanden ein achtstöckiges Institutsgebäude und die „Muschel“ für die Vorlesungsräume. Die Geisteswissenschaften zogen vom Forum um ins „Philosophikum“, wo die Philosophische Fakultät bald in mehrere Fachbereiche zerlegt wurde. Dort habe ich zuletzt noch als wissenschaftliche Hilfskraft die Bibliotheksaufsicht geführt.
Im Sommersemester 1971 schloss ich meine Promotion mit dem Rigorosum ab Das Prädikat „summa cum laude“ machte mich natürlich stolz. Als ich zur letzten mündlichen Prüfung zu Elisabeth Noelle-Neumann in ihr Arbeitszimmer im Haus Recht und Wirtschaft kam, blickte ich durch das Fenster auf jenes Wäldchen, in dem ich zwei Jahrzehnte zuvor als Kind gespielt hatte. Mit der Promotion in der Tasche, stand ich vor einer Weggabelung: Journalismus oder Wissenschaft. Es hätte der Journalismus werden können, da ich inzwischen auch ein journalistisches Volontariat absolviert hatte. Dass es dann aber die Wissenschaft wurde, war einem Zufall – oder soll ich sagen: Glücksfall – zu verdanken. Die Universitätsverwaltung hatte irrtümlich eine Überzahl an Studierwilligen für die zunehmend nachgefragte Publizistik zugelassen. Diese konnten nachträglich nicht mehr exmatrikuliert werden. Den Mehrbedarf an Lehre wollte die Verwaltung durch Bereitstellung einer weiteren Mitarbeiterstelle beheben. Es gab bis dahin im Institut nur zwei davon. Ich war gerade frisch examiniert und noch ohne festes Engagement. Da bot mir Frau Noelle-Neumann diese Stelle an und dies eröffnete mir letztlich eine akademische Laufbahn. Allerdings war die Stelle zunächst einige Semester lang nur befristet, bis sie 1974 im Stellenplan verankert wurde. Vorher allerdings schon war mir eine andere wichtige Erfahrung beschieden, die viele auch machten: dass die Universität immer eine Institution zur Eheanbahnung war.
Mit dieser Anstellung verbunden war ein Frontwechsel. Wo ich bisher als Student mich in der Position eines Schülers befunden hatte, sollte ich fortan selbst als Lehrer auftreten und unterrichten. Das waren zunächst erst einmal Proseminare und Methodenkurse. Damals begann gerade das Zeitalter der Datenverarbeitung. Wir hatten im Keller des Instituts eine Hollerithmaschine, wo man selbst Auszählungen mit Lochkarten vornehmen und die Datenverteilung unmittelbar daran ablesen konnte, wie die einzelnen Fächer sich füllten. Ein Riesenfortschritt war schon, als man seine Lochkarten in das inzwischen geschaffene Rechenzentrum bringen und dort auswerten lassen konnte.
Um auf die nächsthöhere Stufe der akademischen Hierarchie zu gelangen, bedurfte es einer Habilitation, für die man damals in der Regel noch eine eigene Schrift anfertigen musste. Ich legte die meine 1982 vor. Sie behandelte jetzt ein publizistikwissenschaftliches Thema (mit historischem Hintergrund), den Wandel der Berichterstattung deutscher Zeitungen vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Ein Jahr dauerte das Verfahren – es mussten fünf Gutachten geschrieben werden. Am 29. Juni 1983 bestand ich mit dem Habilitationscolloquium die „Prüfung“ und mir wurde die Lehrbefugnis für Publizistikwissenschaft erteilt. Drei Tage später feierten wir in dem Garten unseres Hauses in Drais ein rauschendes Fest.
Es gehört zu den glücklichen Fügungen meines Lebens, dass ich bereits ein halbes Jahr später einen Ruf auf eine C 4-Professur erhielt. Das hatte damit zu tun, dass unser Fach in eine Phase der Expansion eingetreten war. Der Ruf kam von der Katholischen Universität Eichstätt, wo ein neuer Journalistik-Studiengang eingerichtet worden war. Für ihn sollte ich als erster Lehrstuhlinhaber zuständig sein. Ich nahm nach den üblichen Verhandlungen den Ruf an und wir verließen Mainz sehr rasch, weil meine Anwesenheit in Eichstätt wegen der dort bevorstehenden Aufgaben unumgänglich war. Unser Haus in Drais vermieteten wir erst einmal.
Dass wir wieder nach Mainz zurückkehren würden, war damals überhaupt nicht absehbar, obwohl dies manche später gedacht haben mögen. Hier musste die Nachfolge von Elisabeth Noelle-Neumann möglichst bald besetzt werden. Sie hatte sich plötzlich und unerwartet zum Ende des Sommersemesters 1983 emeritieren lassen. Ich selbst musste mich erst einmal woanders bewähren und war auch im Prinzip für eine Neuberufung zwei Jahre gesperrt. Allerdings gerieten die Umstände schon bald in Fluss, weil ich 1985 einen Ruf an die Ludwig Maximilians-Universität in München erhielt. Und dann kam eines Tages die Anfrage aus Mainz, ob ich mir eine Rückkehr dorthin vorstellen könne. Es war bis dahin nicht gelungen, die Stelle von Frau Noelle-Neumann nachzubesetzen.
Das alles brachte mich in eine komplizierte Situation. Zwar hatten ich und meine Familie uns in Eichstätt sehr wohl gefühlt, sowohl was die beruflichen Aufgaben als auch das Lebensumfeld in Bayern anbetraf, das wir gut kennen und lieben lernten. Aber es war klar, dass ich nicht an der „kleinen“ Universität auf Dauer bleiben würde, wenn sich Chancen an einer großen böten. Das war dann ja auch der Fall, und ich hatte zwischen München und Mainz zu wählen. Dies wurde die schwierigste Entscheidung meines Lebens und sie war in der Familie umstritten. Den Ausschlag gab schließlich, dass ich das Mainzer Institut als gut organisiert kannte. Hier funktionierte der NC, den es in München nicht gab, was dort zur Folge hatte, dass damals schon 3000 Studierende im Fach Kommunikationswissenschaft eingeschrieben waren. Im Übrigen ging es in Mainz um die Nachfolge von Frau Noelle-Neumann, die man nicht leichthin ausschlagen konnte.
So kehrte ich abermals nach Mainz zurück, zum Sommersemester 1988. Meine Rolle hatte wieder gewechselt: Jetzt war ich Universitätsprofessor mit all den Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung. Die Selbständigkeit und Verantwortung waren gewachsen, auch wenn sie in der zunehmend bürokratisieren Universität an Grenzen stießen. Wenn ich in die Zukunft blickte (und gesund blieb), hatte ich 20 Jahre vor mir. Tatsächlich wurden es dann 23.
Bei meiner Rückkehr residierte das Institut für Publizistik immer noch in seinem alten Domizil, hatte inzwischen allerdings die Bauleitung vertrieben und auf Nachbargebäude übergegriffen. Dort zog ich nochmals in eine „Wohnung“, bis die dislozierten Teile des Instituts 1974 in einem anderen Gebäude zusammengeführt wurden, das den Namen SB II (Sonderbau) trägt und auch so aussieht, wie der Name es sagt: architektonisch einfallslos, beileibe kein Highlight, aber vorteilhaft wegen des Platzes. Das verschaffte mir, der ich noch überwiegend mit Papier arbeitete, geräumigere Arbeitsbedingungen. Ein Foto auf meiner Website im Internet zeigt das noch (juergen-wilke.net). In meinem Dienstzimmer mit Blick auf den Botanischen Garten hielt ich hunderte von Sprechstunden und beriet die Studierenden bei ihren Seminar- und Magisterarbeiten. Im Sommer war es da wegen der großen Fenster wie im Treibhaus. Der starke Andrang machte zeitweise die Portionierung der Termine im Viertelstundenrhythmus notwendig. Insgesamt habe ich in den 30 Jahren in Eichstätt und Mainz rund 350 Diplom- und Magisterkandidaten und -kandidatinnen betreut. Hinzu kamen die Doktoranden. Dazu mussten tausende von Seiten Gutachterprosa geschrieben werden.
Im Laufe meiner Zugehörigkeit veränderte sich die Universität in vielerlei Hinsicht, einiges blieb aber auch gleich. Die Studierendenzahlen stiegen weiter an bis auf über 30000. In der Publizistik waren es mehr als 1000, was eine Vermehrung des Personals bei den Professoren und im Mittelbau notwendig machte. Zugleich dehnte sich die Universität über ihre bisherigen Grenzen in die Bretzenheimer Felder aus, noch vorhandene Privatwohnungen auf dem Campus wurden aufgelöst. Fast immer wurde irgendwo neu gebaut oder renoviert. Ein ehrgeiziges Vorhaben war die Errichtung des Georg Forster-Baus für die Sozialwissenschaften, Kunstgeschichte und Erziehungswissenschaft. Ihm musste das Mainzer Kolleg weichen, also das Studentenheim, in dem ich zu Anfang meines Studiums einige Semester lang gewohnt hatte. Es dauerte Jahre, bis mit der neuen Bebauung begonnen wurde. Die Fertigstellung fiel 2012 mit meiner Pensionierung zusammen. Statt dorthin umzuziehen, hieß es jetzt auszuziehen.
Präsidenten (und Kanzler) wechselten, die Verwaltung aber gewann eher an Macht. Gleich blieben die Probleme mit dem Geld, es gab immer zu wenig. Vier Jahre amtierte ich als Dekan des Fachbereichs Sozialwissenschaften und hatte mit den Verteilungsproblemen und Sparauflagen zu tun. Allerlei Reformprojekte wurden diskutiert, einige verwirklicht, andere verworfen, beispielsweise die unpraktikable Idee, dass die Institute für ihre Räume Miete zahlen sollten, um möglichst sparsam damit umzugehen. Was sich als undurchführbar erwies. „Erfolg“ beschieden war hingegen der Einführung neuer Studienpläne nach dem europaweit vereinbarten Bologna-Modell. Die Universitätsprofessoren waren damals überwiegend dagegen, mussten sich aber dem ministeriellen Oktroi beugen. Andernfalls wären die Studiengänge 2015 eingestellt werden. Ich selbst habe an dieser Umstellung noch mitgewirkt, doch wollten wir anfangs noch zu viel von dem Bisherigen beibehalten. Das mussten dann andere später korrigieren.
Als ich 2012, nach drei zusätzlichen Jahren, als Universitätsprofessor in Mainz in den so genannten „Ruhestand“ trat, begann für mich eine neue Lebensphase. Als „Befreiung“ erlebte ich den Wegfall der Lehraufgaben. Nicht, dass ich nicht gern unterrichtet hätte, im Gegenteil. Als angenehm empfand ich jetzt die zeitliche und lokale „Entbindung“, so dass man nicht mehr jede Woche in einem Hörsaal oder einem Seminarraum antanzen musste. Zudem brauchte ich mich nicht mehr den neuen schematischen BA- und MA-Studiengängen zu unterwerfen; und auch die digitale Lehre, jüngst durch die Corona-Pandemie, blieb mir erspart. Schon lange bevor diese auftrat, sah ich mich ins „Home Office“ versetzt, wo jetzt über ein Jahr auch die aktiven Kolleginnen und Kollegen arbeiten mussten. Die neue Freiheit kam meinem Interesse, weiter zu schreiben und zu forschen, zugute. Und dafür benutze ich weiter als „Gast“ die Einrichtungen der Universität, insbesondere die unentbehrliche Universitätsbibliothek. Wenn ich im Jahr 2020 auf dem Campus unterwegs war, sah ich diesen – bedingt durch den „Notbetrieb“ der Universität in der Corona Krise – so leergefegt, wie nie zuvor. Es war ein gespenstischer Eindruck, der jetzt meine Erinnerungen an mehr als 50 Jahre überschattet. Aber die Hoffnung ist da, dass das Leben dorthin auch wieder zurückkehren wird.
Mündliche Erinnerungen von Zeitzeug:innen
Geburtsjahr: 1925
Studienfach: Katholische Theologie, später Philosophie
Immatrikulation: 1948
Dr. Abele studierte zunächst Katholische Theologie, später Philosophie. Neben dem mündlichen Zeitzeugeninterview liegt ein 25seitiger, schriftlicher Zeitzeugenbericht vor.
Geburtsjahr: 1929
Studienfach: Medizin
Immatrikulation: 1950
Dr. Afschar war der 13. iranische Gaststudent an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
Geburtsjahr: 1923
Studienfach: Medizin (im ersten Semester noch Naturwissenschaften)
Immatrikulation: 1946
Geburtsjahr: 1925
Studienfach: Medizin, später Zahnmedizin
Immatrikulation: 1946/47
Geburtsjahr: 1925 und 1927
Studienfach: Chemie, Mathematik, Physik (Lehramt) und Chemie, Physik, Geographie (Lehramt)
Immatrikulation: 1946/47 und 1947
Geburtsjahr: 1928
Studienfach: Rechtswissenschaft
Immatrikulation: 1946
Der Vater von Prof. Karl Molitor wurde 1946 als Professor an die damals neugegründete Johannes Gutenberg-Universität Mainz berufen und wurde der erste Dekan der Rechts- und Wirtschaftswissenschaflichen Fakultät.
Mathilde Rüßler war von 1946 bis Ende 1948 als Sekretärin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz beschäftigt. Ihre erste Anstellung fand sie im Lehrstuhl von Hr. Prof. Reut[t]i (Rechtswissenschaft). Nach dessen Tod wechselte sie in das Rektorat, wo sie mit der Korrespondenz des Prorektors Prof. Erler und des Rektors Prof. Schmid befasst war.
Studienfach: Rechtswissenschaft
Immatrikulation: 1946
Publizierte Erinnerungen von Zeitzeug:innen
Die Geschichte der ZMK-Klinik der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist ein Musterbeispiel für die Aufbauleistungen nach dem II. Weltkrieg wie auch für die Entwicklung der modernen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Diese Klinik ist nach 1946 aus dem Nichts entstanden und konnte nur durch gemeinsame Bemühungen von Universität, ihren Lehrenden und den Studierenden verwirklich werden.
Karlheinz Kimmel:
Die Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 1948-1968
Beiträge zur Geschichte der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Neue Folge - Zeitzeugenerinnerungen
Band 1
1. Auflage 2007
28 S., 13 s/w Fotos. Kartoniert
€ 16,00 / €(A) 16,50 / sFr 27,20
ISBN 978-3-515-09094-0
Kontakt
Sie haben Fragen? Dann wenden Sie sich an: